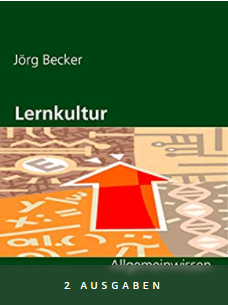Egal wie groß die Datenmenge auch sein mag, ein Grundgesetz des Organisierens lässt sich damit nicht erschüttern: Entscheidungen müssen getroffen werden – immer noch unter den Bedingungen begrenzter Rationalität“. Die Hoffnung trügt, errechnen zu können, was es eigentlich zu entscheiden gilt. Denn wo bliebe sonst das Unbekannte, die kreative Idee? Nur weil etwas formal weniger strukturiert ist, ist etwas nicht weniger wertvoll oder gar verzichtbar. Es geht darum, mehrere Methoden anzuwenden, Vor- und Nachteile der Abstraktion und Vereinfachung gegeneinander abzuwägen und vor allem zu lernen, wie das Eine mit dem Anderen zusammenhängt und wie die jeweiligen Ergebnisse zu interpretieren sind. Die Vision an der Schwelle zur Wirklichkeit: lauter kleine Computer begleiten den Menschen bei allen erdenklichen Alltagsdingen in ein angenehmeres Leben: ein Smart Home, das dem Menschen noch weit mehr abnimmt als sein gegenwärtiges (bereits nahezu unverzichtbares) Smart Phone. Ganze Häuser mutieren zu Maschinen und dienen ihren Bewohnern, ohne noch irgendetwas bedienen zu müssen. Kritisch ist eher nicht die Verfügbarkeit von Daten. Sondern kritisch ist eher die Kunst, an diesen Informationswust die richtigen Fragen zu richten. Um an die richtigen Informationen zu gelangen und aus diesen nutzbares Wissen zu generieren. Was wie wo zu speichern ist, richtet sich nach dem Kriterium der Nützlichkeit. Aber wer weiß schon sicher, welche interessanten Schlüsse sich in ein paar Jahren aus gespeicherten Daten ziehen lassen. Wer weiß schon sicher, welche bislang noch unbekannten Zusammenhänge sich aus gespeicherten Daten vielleicht noch berechnen lassen.
 Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz
Wissensbasierte Ökonomie
Region RheinMain
Lokale Standortbeobachtungen
Standortbilanz u. Personalbilanz